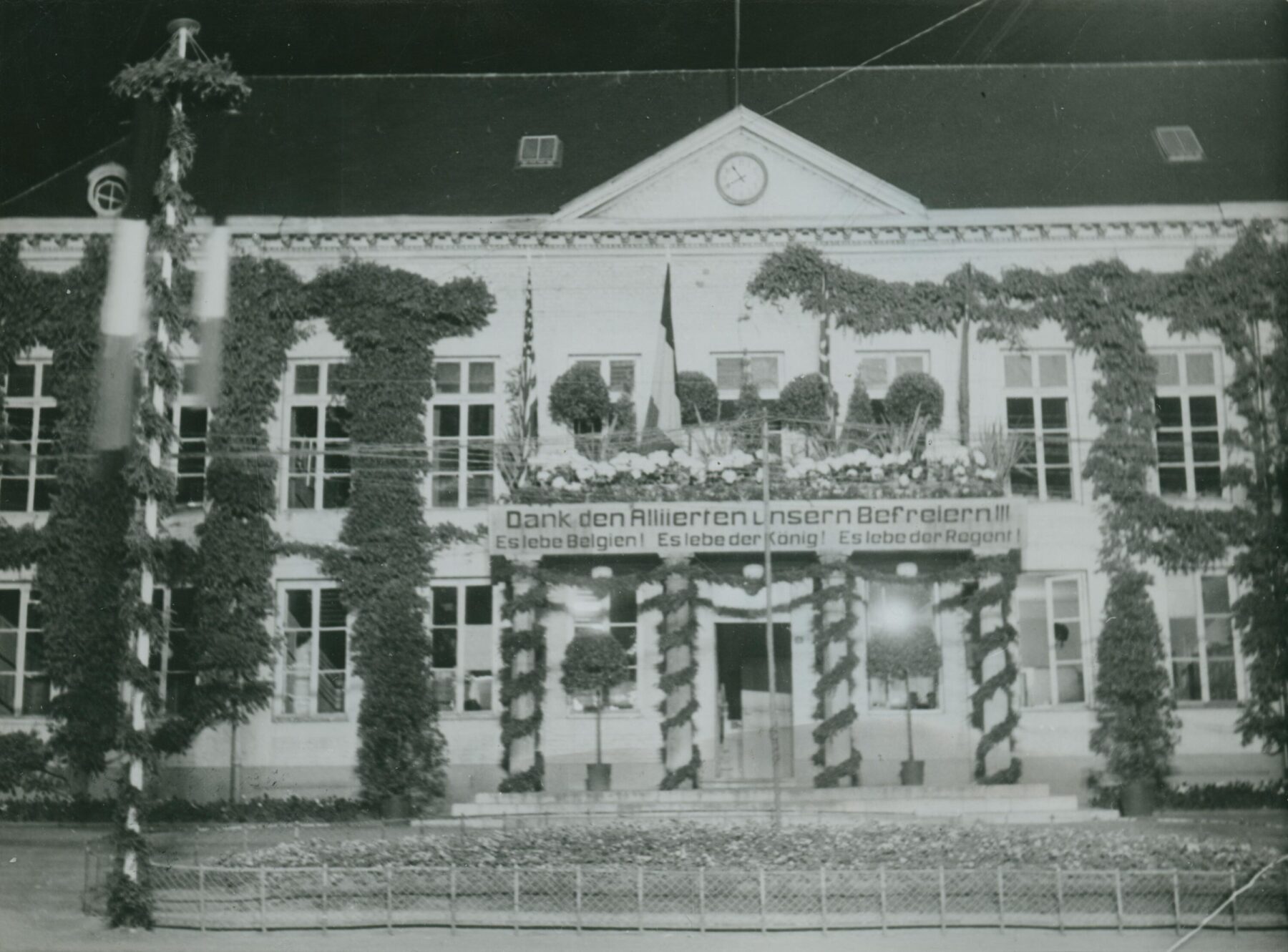Hatte der NS-Staat ab Mai 1940 die neue Grenze nach Belgien hin geschlossen, alle Französischunterrichte eingestellt, das öffentliche Leben weitgehend „verdeutscht“ und auch französische Personennamen eingedeutscht, so bemühte sich nun der belgische Staat, die deutsche Sprache aus der Region zu verdrängen und das öffentliche Leben wieder umzugestalten. Die besten Mittel dazu schienen die Französisierung der Jugend durch das Unterrichtswesen zu sein, die geistige Orientierung der Ostbelgier nach Innerbelgien, die Verbreitung eines starken belgischen Nationalismus sowie die weitgehende Schließung der deutsch-belgischen Grenze für die Nachkriegsjahre. Gleichzeitig schritten nicht wenige Ostbelgier zur „Selbstassimilierung“ über, indem sie die deutsche Sprache zum Teil selbst verwarfen und manchmal willentlich ihre deutschen Vornamen ans Französische anpassten. Aus „Dieter“ wurde nun „Didier“, aus „Maria“ wurde „Marie“.
Ab den 1950er Jahren regte sich in Ostbelgien vereinzelt Widerstand gegen diese Politik. Weiteren Aufschwung erhielt diese Entwicklung ab den 1960er Jahren durch die Spannungen zwischen Flamen und Wallonen. Vor allem ein Teil der jungen Generation in Ostbelgien bemerkte, dass er gegenüber Flamen und Wallonen nicht gleichberechtigt war.
Diese Entwicklung brachte zwei politische Meinungslager hervor: Auf der einen Seite standen die traditionellen Parteien, die zunächst wenig selbstbewusst den Respekt vor der deutschen Sprache anmahnten, wie er durch die Festlegung der Sprachengrenzen von 1962-63 vorgesehen worden war. Auf der anderen Seite standen junge Politiker, die über die 1971 gegründete Partei der deutschsprachigen Belgier die sofortige Gleichbehandlung und die gleiche Autonomie forderten, die Flamen und Wallonen gewährt wurde.
Bei den belgischen Politikern, die den Zentralstaat in einen Bundesstaat umbauen wollten, setzte sich die Einsicht durch, dass der Respekt vor der Kultur des anderen (Flamen, Wallonen, zweisprachige Brüsseler und Deutschsprachige) wichtig ist. Denn Kultur ist eine Ausdrucksform der Identität eines Menschen. Die „Charta der autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen in Europa“ der FUEN (2006) begründet dies: Minderheitenpolitik ist aktive Friedenspolitik, trägt zum kulturellen und sprachlichen Reichtum bei und unterstützt das Selbstbestimmungsrecht der Menschen.
Bis zur Jahrtausendwende wurden diese politischen Auseinandersetzungen in Ostbelgien kontrovers diskutiert: Die einen forderten gleiche Mitspracherechte, die anderen argumentierten aus einer Perspektive der Vorsicht und wollten durch die guten Beziehungen zu den jeweiligen Mutterparteien in Brüssel allmählich Vorteile für Ostbelgien erzielen.
-
![Michel_Pauly]()
Michel Pauly
Meinung:
Zur Situation sprachlicher Minderheiten in Luxemburg:
„In Luxemburg ist die Diskussion über die Art, wie man mit Minderheiten umgehen sollte, sehr groß, da es neben einer knappen Mehrheit an Luxemburgern, große portugiesische, französische und italienische Minderheiten und unzählige kleinere und kleinste Minderheiten, die alle zusammen das luxemburgische Volk bilden, gibt. Dazu kommen noch einige hunderttausend Grenzgänger aus Frankreich, Belgien und Deutschland, die jeden Tag nach Luxemburg kommen, um dort zu arbeiten. Wenn die aktuelle massive Einwanderung anhält, wird die Zahl der Luxemburger in Luxemburg in den nächsten Jahren unter 50% fallen. Dann wird das luxemburgische Volk nur noch aus Minderheiten bestehen. Deshalb ist die Frage über den Umgang mit Minderheiten im eigenen Land von existenzieller Wichtigkeit, u.a. weil, theoretisch in einigen Jahren, dann weniger als die Hälfte der in Luxemburg lebenden Menschen wahlberechtigt sind, und das wird zu einem demokratischen Defizit führen, in dem eine angestammte Minderheit über alle andere bestimmen wird. Das Problem, dass zu wenige Einwanderer Luxemburgisch – die Integrationssprache in Luxemburg – lernen würden, stimmt so nicht und kann mit einem Blick auf diesbezügliche Statistiken direkt von der Hand gewiesen werden. Ein anderes Problem ist eher die Angst der angestammten Luxemburger, dass das Französische, was in ganz Luxemburg in verschiedenen Situationen des Alltags gebraucht wird, das Luxemburgische verdrängen würde. Diese Angst ist irrational und basiert auf Gefühlen, die in unüberlegten politischen Abenteuern ausarten kann. Dieses „Schreckensszenario“ wird aber nicht stattfinden, solange Luxemburgisch die Integrationssprache bleibt und man an der Dreisprachigkeit Luxemburgs festhalten wird.“